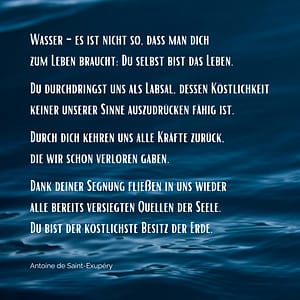Kalium, das siebenthäufigste Element der Erdkruste, ist ein hochnervöses Kerlchen: Mit nur einem Außenelektron ist es stets bemüht, stabile Verbindungen mit anderen Stoffen einzugehen und kommt in der Natur somit nur in chemischen Verbindungen vor, zum Beispiel als Katzenglimmer (der ist wirklich so hübsch wie sein Name!).[1] Besonders mit Wasser reagiert Kalium äußerst leidenschaftlich – kommt der bei dieser Reaktion freigesetzte Wasserstoff mit Sauerstoff in Berührung, gibt es eine Explosion, die jeden Special-Effects-Profi in Hollywood vor Neid erblassen lässt.
Im November 1807 berichtete Humphry Davy der Royal Society of London, dass es ihm gelungen sei, durch Elektrolyse zwei Metalle zu gewinnen: zum einen Sodium (die französische und englische Bezeichnung für Natrium) und zum anderen Potassium, das er aus Pottasche gewann. Der Name Potassium wird noch heute in Frankreich und Großbritannien benutzt, in Deutschland heißt derselbe Stoff Kalium, nach dem arabischen القَلْيَة bzw. al-qalya = aus Pflanzenasche gewinnbar.